|
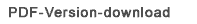
Erich Mansen - Nähe und Ferne
Galerien für Kunst und Technik Schorndorf
24.01. - 07.03.2010
Eröffnung: 24.01.2010, 11.00 Uhr
Als der Zeichner und Maler Erich Mansen von seinen Bildern spricht, fällt der Begriff von sinnlichen Orten. Umgehend wird im Gespräch dabei allerdings deutlich, dass mit der einzelnen Tuschzeichnung, dem einen Aquarell oder dem je anderen Gemälde nicht etwa ein bestimmter Ort - ein Ankommen, ein definiertes Ziel und damit auch ein Ende - gemeint sei, vielmehr das zeichnerische wie das malerische Tun als solches im Empfinden und Wahrnehmen von Sinn und Sinnlichem sich immer wieder neue, unbekannte Orte suche. Zunächst verschlossen (vielleicht sogar hermetisch abgegrenzte Eigenwelt) zeigt sich dieses rätselhafte Zwischenland zwischen dem bekanntermaßen Unfassbaren allen Sinnlichen einerseits und dem handgreiflich nahen, konkret bezeichenbaren (und gemalten!) Ort auf der anderen Seite. Wie also kann ein Augen-fest-Machen - mag man sich unwillkürlich fragen - in jenem sich so widerständig sträubendem (Da)Zwischen nur vonstatten gehen?
Kurt Leonhard (es steht der 100. Geburtstag an) schreibt dazu in seinen 1995 entstandenen Lichtensteiner Notizen über die Malerei von Erich Mansen: „Farben können innerhalb schwarzgrauer Zeichenkonstellationen zu Gast geladen sein, aber dennoch die Bildwirkung entscheidend bestimmen. Gegenstände können eindeutig erkennbar sein, wie Texte einer musikalischen Komposition, oder vieldeutig assoziierbar wie Traumvorstellungen in absoluter Musik, aber sie können auch völlig verschwinden, wenn das Bild selbst zum Gegenstand wird.“
Selbst lange schon die hölderlinische Hälfte des Lebens überschritten gilt es also mithin Spuren, Pfade, Wege des unlängst 80 Jahre alt Gewordenen zu verfolgen, der sich - analog der bildnerischen Arbeit - multipel vielgestaltig in den vielen weiteren Zwischenländern von Geistesgeschichte, Philosophie, Literatur, Musik und anderen Reichen tummelt, um sich Wittgenstein und Celan und Matisse und Hölderlin und viele andere mehr geistreich behände einzuverleiben. Doch über Generationen und die jeweiligen Lebensstationen hinweg (Flensburg, Karlsruhe, Paris, Schleswig, Stuttgart, Kisslegg, Reutlingen, Lichtenstein, die Reisen sämtlich ausgelassen), während Studienzeiten oder langjähriger Lehrtätigkeit an der Akademie, gehen sich gleich geglaubte Wege aber immer ganz verschieden: erst einmal aus dem Atelier in die Öffentlichkeit verbracht ist nämlich ein und dieselbe Leinwand - selbst unter nur vier Augen besprochen - noch mindestens zwei Bilder, der identisch geglaubte Text wenigstens zwei Interpretationen wert, dasselbe Musikstück über mehr als ein einziges Verstehen, Meinen oder Fühlen hinausreichend.
Entlang der nicht eben leicht verständlichen Hymnik des bereits genannten Friedrich Hölderlin etwa entwickelte Erich Mansen im Jahre 2004 einen umfangreichen Zyklus von Zeichnungen und Aquarellen unter dem Titel Ein Zeichen braucht es, der auf einen Vers des um 1805 entstandenen Textes des Dichters zurückgeht. (In der Ausstellung sind 9 vierteilige Zeichenblätter daraus zu sehen.) Angesichts nun des so viele Dezennien umfassenden bildnerischen Werkes von Erich Mansen, von dem hier freilich nur ein flüchtiger Ausschnitt gewährt werden kann, ist man allenthalben versucht, das ursprüngliche Motto geringfügig abzuwandeln: von: Ein Zeichen braucht es zu: Die Zeichnung braucht es. Denn Erich Mansens Malerei - auch die in der aktuellen Präsentation gezeigten Stücke aus den vergangenen 8 Jahren samt einer Reprise zurück in die 1980er und 1990er - erscheint nach wie vor vom Zeichnerischen ganz geprägt, dem Liniengestus, den schwarz und weiß abgegrenzten Farbflächenfeldern, der Rhythmik sukzessive angesetzter, nachvollziehbar gerichteter Pinselbahnen, einer zersprengten Ornamentik der Zeichen auch (wie noch eines der Gemälde selbst betitelt ist).
Im Unterschied aber zu den Papierarbeiten, die einzelne Chiffren, ein fragmentarisches Schreiben, spontan-intuitive Linienläufe ¬- lyrischen Farbversen gleich - aus dem Papierweiß herausleuchten lassen, ist der Malgrund dagegen vollkommen durchgearbeitet; die einzelnen Texturen der losen Blätter - Wortfetzen, Gedankensplittern, Erinnerungsbildern gleich - zum kompakten Maltext verdichtet, in Malwerke trocken gesetzter Ölfarbe eingewoben. Die Zeichen sind hier vielfach in menschengemäß lebensgroße Areale zusammengeflossen, die Farbe gießt sich in die Gegenstände ein, die sich durchscheinend oder opak formieren, in geometrischen Ordnungen Strukturen finden oder aber naturhaft organisch anzuwachsen vermögen. Wenn im zeichnerischen Tun zuvorderst das Entwerfen, ein Sich-Treibenlassen vom just so Gefundenen, das Erfassen und Erscheinen zyklisch Blatt um Blatt entwickelt sind, prägt die Malerei ganz und gar die formatdurchdringende Bildessenz, die - über das lyrisch Offene des Papiergrundes - nach einem Gültig-Letztgültigen zu forschen ansucht.
Durchaus autonome Einzelarbeiten so konstituierend mag dennoch auch der Versammlung der hier ausgestellten Gemälde von Erich Mansen eine Art (sagen wir mal) Malkontinuum - gewissermaßen ein Fortschreiben/immer Fortschreiten an sinnliche Orte in Farbe und Fläche - anzumerken sein. Neben Triptychen, deren Mehrteiligkeit ohnehin ja im unmittelbaren medialen Zusammenhang zu sehen sind, verweisen besonders auch charakteristische Farbstellungen von Grün- und Blautönen, von Schwarz und Weiß, mitsamt den sie mittelnden (aschenen) Graupartien, denen der Betrachter immer wieder begegnet, auf innere Zusammenhänge bzw. das Denken und Arbeiten in Folgen - und damit auch auf den Faktor Zeit - hin; zumal die aus früheren Werkphasen des Künstlers bekannten Motivchiffren von Fächern, Blütenformen, vielfarbig gefassten Rechtecken, Prismen und anderer architektoraler Gefüge neu aufgegriffen und ausformuliert werden.
Auch andere Bildvergangenheiten - diejenigen nämlich früherer Epochen und Meister - vibrieren gleichsam in den Leinwänden mit, ohne dass hier ein allzu nah ins Gegenständliche gehendes kunsthistorisches Vergleichen das Sehen wirklich beförderte. Quasi Beckmann'sche Schwärzen etwa schmiegen sich an menschliche Körperformen, die ebenso allgemeiner gehalten Gefäße sind, die gleichzeitig rudimentär wie Schwarzlot- und Bleifassungen mittelalterlicher Glasfenster erscheinen, und es doch nur wieder (und nichts weniger als das) ein schlicht virtuos gefasstes Farblicht-Stilleben ist. An anderer Stelle treten dem Betrachter in schier kirchnerisch nervöser Grelle von Grünem und Gelbem ein auffahrend impulsiver Pinselduktus entgegen, die wir aus der Bildkunst von Expressionismus und Kubismus stammend mit anhaltend archaisch-ursprünglicher Kraft hier nachzuwirken vermeinen.
So bleiben auch dem Betrachter Fluchten zugestanden - und Fluchten ist das zentrale Triptychon dieser Ausstellung ja benannt -, und damit unterschiedliche Lesarten überlassen, die die drei Tafeln als Einzelbilder oder aber als Gesamtwerk definieren. Sie mögen angesichts ihrer Flügel je Figürliches, je geometrisierende Farbarchitekturen oder zuletzt naturhafte Landschaftsanmutung repräsentieren. Zusammengesehen knüpfen sie aber genauso gut fast schon konspirativ erzählerische Bande, wenn unversehens der dunkle Totem da erwartungsvoll vor dem im hellen Grund schwebenden Stein der Weisen sitzt, während sich hinter der finsteren Wand, in die das prezios strahlende Auge eingebettet ist, der kristalline Tabernakel in Wildnisse zurückverwandelt, die den aschegrauen Abhang nach rechts hinabzustürzen drohen … die Perspektiven kippen, Akteure verwandeln sich, die Gegenstände und die Orte wechseln, die Wege von Deutung und Bedeutung verlieren sich wieder - in sich selbstvergessen, was häufig nicht als Schlechtestes erscheint.
Die Fluchten hier jedoch sind nie ein Fliehen wovon oder wovor, sondern ein stets sich neu befragendes Wohin. So male er - wie der Künstler selbst bekennt - „seine Bilder [durchaus] auch um ihrer Fremdheit willen“. Der so genannte Umstand (von Fremdheit) vermag nun mitnichten dem Rezipienten dieser vorgestellten Universen die angestrebte Annäherung an das einzelne Werk zu erleichtern. - Die Koordinaten dieserart selbständig vernetzter Sinneindrücke, biografer Erfahrungen sowie der komplexen Aneignung von Geschichte und Kunstgeschichte von Seiten des Malers muss notgedrungen beim Betrachter ja zu einer völligen Ortlosigkeit von Wahrnehmung und Verständnis führen. Gerade aber die geschilderte (Ortlosigkeit) mag vom Urheber jener Bildwelten allerdings bewusst angestrebt sein, um - über einmal eingenommene Standpunkte, behauptete Theoreme und Erfahrungen hinaus - ein inneres System des sinnlichen Ortens (als intensives Hineinhorchen, Mitempfinden, Nachspüren) menschlicher Existenz sowohl für sich selbst gewährleisten, als auch vom Bildgegenüber des Schauenden mit jedem neuen Bildnis einfordern zu können.
Zu dieser Nähe und Ferne - dem Titel der Schorndorfer Ausstellung - heißt es bei Karl Kraus an einer Stelle: „Je näher man ein Wort anblickt, umso ferner blickt es zurück.“ In diesem Sinne bleibt die Malerei von Erich Mansen uns verheißungsvoll mysteriös, denn wieviel mehr gilt für sie: Je näher man ein solches Bild anblickt, umso ferner blickt (dies)es zurück!
Clemens Ottnad M.A.
Kunstverein Reutlingen
|
|
|
