|
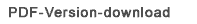
Bernd Rau, o. J.
Erich Mansen oder die Verwandlung der zeichnerischen Elemente in Natur
„Die Zeichnung als Thema des Zeichnens selbst oder die Zeichnung als Ort, wo körperliches und geistiges Befinden, ja Empfinden, psychische und physische Energien einander begegnen, wo seismographische Bewegungsprotokolle und individuelle Körpererfahrung einander gleichen, als Ort, wo illusionistische Wiedergaben der sichtbaren Welt ihren Platz haben können, die Zeichnung nimmt so zeitgenössische Gestaltungsmöglichkeiten wahr. Als eigenständiges Darstellungsmittel hat so auch die Zeichnung in jüngster Vergangenheit zunehmend schöpferische Ausschließlichkeit erlangt.
Erich Mansen hat schon immer in der Zeichnung sein ureigenes künstlerisches Element, sein charakteristisches Metier gesehen. Er hat seit seinen Arbeiten aus den Jahren 1962/1963 ein umfangreiches zeichnerisches Werk vorgelegt. Die Zeichnung offenbart sich ihm stets in ihrer reinen, ursprünglichen Eigenschaft: Mansen begreift sie vor allem schwarz-weiß als Strich, als Punkt oder Linie; er bedient sich dabei weder des Bleistifts noch des Pinsels, sondern der Feder. Der freiwillige Griff zu diesem scheinbar harten und spröden Instrument mag wie ein großzügiger Verzicht auf das vielfältige graphische Vokabular anmuten; er enthält aber für den Künstler die Voraussetzung zur Entfaltung des ganzen zeichnerischen Reichtums.
Die absichtsvolle Entscheidung für das denkbar einfache Instrumentarium kann besagen, dass die Zeichnung auf ihre erste schöpferische und formale Rolle zurückgeführt ist, in der Schrift aus Zeichen entstand. Sie ist von der Zeichengeste, nicht von der Schreibgeste geprägt. Jenseits der Kalligraphie verfügt Mansen über die Geste des Zeichners. Wie der Zeichner Mansen in unmittelbarem Zusammenwirken von Auge und Hand Abstände bemisst, übrigens bei einer besonderen Vorliebe für das Hochformat, so bestimmt er nach seinem eigenen Rhythmus die Aktion und die Darstellung. Zeichnen bedeutet für ihn ein Stadium der Anspannung. Gespanntheit, Konzentration charakterisieren den Strich, der nicht schlingert, nicht zögert. Klar und bewusst und schnell ist der Strich gezogen, Spontaneität und Bewegung und Strahlkraft zugleich aufweisend. Er gewinnt je nach Intensität besondere ‚Bedeutung’: Er steht als Kriterium der Räumlichkeit und der Körperlichkeit der Formen auf dem Blatt. Die Fläche behauptet sich als ein mächtiges Feld, das Gewicht und Gegengewicht, Kontrast und dessen Ausgleich kennt. Die verströmende Energie der bald einzeln, bald gebündelt auftretenden Striche, die beredsamen Intervalle prägen wesentlich die Erscheinung dieser Zeichnungen. Die Plastizität des Strichs teilt sich dessen Umgebung mit und verwandelt die Grundfläche. Der Strich zeugt in diesem Sinn nicht nur von graphischer Sensibilität sondern auch von Wertunterschieden, die offensichtlich der Farbe entsprechen. Das Gefühl, das er birgt, modelliert die Helligkeit des weißen Papiers, ohne sie zu zerstören. Licht entsteht so aus dem Strichgefüge. Eine Trennung von Binnen- und Umrisszeichnung wird sinnvoll durch den Zeichnungsablauf, durch das rhythmische Kontinuum der Formen aufgehoben. Statt einer Isolierung ergibt sich ein Zusammenhang der einzelnen Formen, in dem die Komposition der Zeichnung ablesbar wird. Die Zusammengehörigkeit, die Verzahnung der verschiedenen Formen greift schließlich sogar über das einzelne Blatt hinaus. Eine Verbindung zur Reihe, die zyklische Arbeit stellt sich als Folge ein. Ein Blatt scheint das andere zu ergänzen, und doch ist jedes als eigener Organismus selbständig und unverwechselbar, sicher und gültig gesetzt.
Aber auch die Spannung zwischen der intensiven Konzentration auf die inneren Verhältnisse der Zeichnung, auf die Beziehungen der Striche zueinander einerseits und der Möglichkeit, gegenständliche Erscheinungen zu umreißen andererseits, ist ein wichtiger Zug dieser Blätter. Eine abbildhafte Wiedergabe der sichtbaren Wirklichkeit hier erkennen zu wollen, wäre verfehlt. Eine vorsichtige Distanz zu figürlichen Motiven und zu deren bestimmten Inhalten ist angeraten. Die künstlerische Absicht zeigt nicht vordergründig in die Richtung einer gegenständlichen Darstellung, auch wenn diese assoziativ bisweilen in landschaftlicher oder vegetabilischer, in anthropomorpher oder architektonischer Gestalt zu ahnen ist. Solche Assoziationen, die unsere Wahrnehmung lenken können, sind in der Tat nicht auszuschließen. Die Zeichnungen stehen ihnen gegenüber offen. Sie sind so besehen keine abstrakten Zeichnungen. Inhaltlich betrachtet, geben die Arbeiten zu erkennen, wie die zeichnerischen Elemente der Natur zugeführt werden. Gleichsam ‚parallel zur Natur’ bietet sich der Strich dar; ihm wohnt die Tendenz inne, Natur zu fassen. Aufschlußreich ist hier die Tatsache, dass Mansen seine frühen Zeichnungen ‚Metamorphosen’ genannt hat. Die Verwandlung der zeichnerischen Elemente in Natur, Mansen macht sie zur schöpferischen Bedingung seines Werks. Unmißverständlich lauten der Anspruch und das Ziel seines Tuns: durch den zeichnerischen Zugriff Natur aus sich herzustellen.
Diese Zeichnungen sind als Gestaltung von Natur zu begreifen. Ihre Darstellung, ihre Form tragen zugleich den Ausdruck der Beobachtung und der Emotion; sie sind jedoch weder Notationen eines psychischen Zustands, noch Beschreibungen einer äußeren Wirklichkeit. Es liegt über diesen lichtvollen und körperreichen Zeichnungen etwas von einem einheitlichen Klang, worin alles einschwingt, worin das Geheimnis der Bedeutung weniger wesentlich als das der Existenz.“
|
|
|
